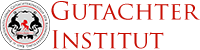Date: 13.08.2024
Baufeuchtigkeit und Bauabdichtung - Schäden und Mängel am Gebäude
Schimmel und
Schimmelbekämpfung
Die relative Luftfeuchtigkeit φ ist das Verhältnis von Partialdruck des Dampfes zu dessen Sättigungsdampfdruck ps. Am Taupunkt ist die relative Luftfeuchtigkeit gleich 1 (=100 %). Als Taupunkt oder Taupunkttemperatur bezeichnet man die Temperatur, bei der sich auf einem Gegenstand bei vorhandener Feuchte ein Gleichgewichtszustand an kondensierendem oder verdunstendem Wasser einstellt, mit anderen Worten die Kondenswasserbildung gerade einsetzt.
Taupunktkurve - Wassersättigung der Luft Zwischen der Lufttemperatur und der Menge an Wasser/ Wasserdampf, welche die Luft bei einer bestimmten Temperatur aufnehmen kann, besteht ein nichtlinearer Zusammenhang. Je niedriger die Lufttemperatur, desto weniger Wasser kann die Luft aufnehmen. Aus energetischer Sicht kennzeichnet “Kälte” einen energiearmen Zustand, bei welchem die Teilchen eines Stoffes, wie z.B. ein Feststoff, Flüssigkeit, Gas usw.) weniger schwingen, als bei höherer Temperatur. Erreicht die Temperatur eines Körpers den absoluten Nullpunkt (-273,15°C), bewegt sich auf molekularer bzw. atomarer Ebene nichts mehr. “Wärme” hingegen ist ein Zeichen dafür, dass sich ein Gas, eine Flüssigkeit oder ein Festkörper auf einem bestimmten Energieniveau befindet. Sie entsteht durch Bewegung der Atome oder Moleküle (Stoß und Reibung).
Wärmedämmstoffe sind Stoffe mit geringer Dichte (zu erkennen am geringen Gewicht). Werden sie von Stoffen mit hoher Dichte (schwere Materialien, z.B. Metalle) durchdrungen, entsteht an dieser Stelle eine Wärmebrücke. Die Wärme bewegt sich dabei vom Ort des höheren Energieniveaus (“warme Seite”) zum Ort des niedrigeren Energieniveaus (“kalte Seite”). Dieser Energietransport wird auch als Wärmestrom bezeichnet. Insbesondere bei wasserdampfdurchlässigen Baustoffen oder schadhaften Gebäudekörpern/- Hüllen/ Rissen, mangelhaften Anbindungen zwischen Bauteilen u. ä. diffundiert Wasserdampf aufgrund des Konzentrationsgefälles durch das Bauteil. An der Stelle, an der die Materialtemperatur niedriger als der Taupunkt ist, kondensiert der Wasserdampf und nässt das Bauteil. Zwischen Lufttemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit besteht eine Wechselbeziehung. Ein Luftvolumen mit einer bestimmten Temperatur kann nur eine begrenzte Menge Wasser in gelöster Form als Dampf aufnehmen. In 1 m³ Luft mit einer Temperatur von z.B. 20°C passen maximal 17,3 Gramm Wasser. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt in dem Fall 100%. Bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit sind im gleichen Luftpaket nur 17,3 g x 50% = 8,65 g Wasser enthalten. Je höher die Lufttemperatur, umso mehr Wasser kann die Luft aufnehmen, und umgekehrt.
Literatur :
(1) Prof. Dr. - Ing. Dipl. - Phys. Klaus Sedlbauer, (2001): Dissertation zur Vorhersage nach Schimmelpilzbildung
auf und in Bauteilen. Universität Stuttgart; Lehrstuhl für Bauphysik.
(2) Lorenz, Hankammer, Lassl (2005) Sanierung von Feuchte- und Schimmelschäden (Bewertungsgrundlage nach
Trautmann 2005); Verlag: Müller, Rudolf
(3) C.Y. Rao, A. Burge und J.C.S. Chang: Review of Quantitative Standards and Guidelines for Fungi in Indoor
Air
(4) Umweltbundesamt (2005): Leitfaden zur Vorbeugung, Untersuchung, Bewertung und Sanierung von
Schimmelpilzwachstum in Innenräumen; Berlin
(5) Landesgesundheitsamt Baden - Württemberg (14.12.2001): Schimmelpilze in Innenräumen - Nachweis,
Bewertung, Qualitätsmanagement; Stuttgart
(6) Landesgesundheitsamt Baden - Württemberg (Februar 2004): Handlungsempfehlung für die Sanierung von mit
Schimmelpilzen befallenen Innenräumen; Stuttgart
(7) Umweltbundesamt (2005): Leitfaden zur Ursachensuche und Sanierung bei Schimmelpilzwachstum in
Innenräumen („Schimmelpilzsanierungsleitfaden“); Dessau
Liegen lungengängige Sporen/ Myzelien vor, die koloniebildend ausblühen und eine Vermehrung weiter stattfindet ist ein vollständige Abtötung und Beseitigung der Schimmel-/ Hefepilze und Bakterien zwingend anzuberaumen. Da die Raumluft ebenso betroffen sein kann, müssen derartige Bereiche ebenfalls behandelt werden bspw. Kalt-/ Warmvernebler, Düsenstrahlgerät, Abtrag, 90%-iger Ethanol, methanolfrei und unvergällt, Fruchtsäuren, Wasserst.-Peroxid, u. dgl.). Bei Bedarf z.B. großflächige Anwendung von Schimmelpilz- und Sporenvernichter kombiniert mit der Vernebelung des Antisporen-Nebels empfiehlt sich auch der Gebrauch von A2-P3 oder A3-P3 Atemschutzfiltern bzw. Kombinationsfiltern wie z. B. A2B2-P3.
Es ist zur definierten Leckageortung ggf. anzudenken sog. Tracer, also Markierungssubstanzen wie fluoreszierendes Kontrastmittel Uranin, Fluorescein einzusetzen. Derartige Kontrastmittel sind in der Lage, un- oder hochverdünnt mit Wasseranteil dem Ursachenverlauf parallel zu folgen und mit UV-gestütztem Licht/ UV-Bestrahlung um 365 nm wässrige Strömungsverläufe, Wasserzungen oder unterirdische Fließwege ersichtlich zu machen.
Weitere Regularien
- VOB Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen DIN 1960
- VOB Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführungen von Bauleistungen DIN 1961
- VOB Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen ATV Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18299
- Bauwerksabdichtungen DIN 18195 (alle Teile)
- DIN 4095 Dränung
- DIN 18201 und DIN 18202 Toleranzen im Bauwesen und Toleranzen im Hochbau
- ATV DIN 18336 Abdichtungsarbeiten
- DIN 18195 Abdichtung von Bauwerken – Begriffe
- DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen
- DIN 18533 Abdichtung von erdberührten Bauteilen
- DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen
- DIN 18535 Abdichtung von Behältern und Becken
- Ergänzend gilt die ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art, Abschnitte 1 bis 5. Bei Widersprüchen gehen die Regeln der jeweiligen ATV DIN vor
Wirksamkeit der Abdichtung
Die Abdichtung soll gegen Waser von unten abdichten. Je nach Wasserdruck bzw. Wasserdampfdruck muss die Abdichtung, in Abhängigkeit vom Oberbelag, auf Dauer unterschiedlich dicht sein. Der Widerstand einer Abdichtung gegen Wasserdampfdiffusion wird durch die Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl µ ausgedrückt. Die Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl µ gibt an, wievielmal höher der Widerstand des jeweiligen Abdichtungsstoffes gegenüber Wasserdampfdiffusion ist, als Luft gleicher Schichtdicke.
Bauliche Erfordernisse
Bei der Planung des abzudichtenden Bauwerkes sind die Voraussetzungen für eine fachgerechte Anordnung und Ausführung zu schaffen. Dabei ist die Wechselwirkung zwischen Abdichtung und Bauwerk zu berücksichtigen und ggf. die Beanspruchung der Abdichtung durch entsprechend konstruktive Maßnahmen in Grenzen zu halten. Das Entstehen von Rissen im Bauwerk, die durch die Abdichtung nicht überbrückt werden können, ist durch konstruktive Maßnahmen, z.B. durch Anordnung von Bewehrung, ausreichender Wärmedämmung oder Fugen zu verhindern. Dämmschichten, auf die Abdichtungen unmittelbar aufgebracht werden sollen, müssen für die jeweilige Abdichtung geeignet sein. Falls erforderlich, sind unter Dämmschichten Dampfsperren vorzusehen.
Die Flächenabdichtung/ wasserführende Ebene zwischen Bodenplatten und ankommendem Bauteil Außenwände muss dicht und gefälletypisch verbaut werden. Sickerungen, Abflussebene für von Wasserzungen müssen gewährleistet sein. Durchdringungen sowie etwaige Risse sind regelmäßig auf dauerhafte Dichtheit zu prüfen.
Der Anordnung einer dauerhaft wirksamen Gebäudeabdichtung muss entsprochen werden. Lässt ein Gebäude wie vorgenannt in Bauteilabschnitten unzulässig erhebliche Nässe/ Feuchtigkeit in das Objekt, welches Bauteilschädigungen forciert oder verursacht, so muss/ müssen Schimmelbekämpfungsmaßnahmen/ Schimmelbekämpfung/ Schimmelbeseitigung und die Sicherstellung der Gebäudeabdichtung gegen Baufeuchte und Folgeschäden eingeleitet werden.
Abdichtung durch bspw. Verpressung/ Injektion innenseitig, betroffene Bauteilflächen durch Bohrungen in die Wände/ Decken/ Böden. Durch Einpressung von Injektionsmittel wird eine Verschleierung/ Vergelung eingebaut, welche zur Herstellung einer ausreichend abgedichteten „Hülle“, folgerichtig für eine Abdichtung, geeignet ist. Gegenstand ist u. a. die nachträgliche innenseitig auszuführende funktionsfähige Ausbildung einer Abdichtung/ Verschleierung/ Vergelung, gegen von außen eindringende, stehende und drückende Feuchtigkeit und Nässe auch in Form von Wasser und Wasserdampf mit teils hohem (Dampf)Druck. Eignung für Schleierinjektion, Baugrundverfestigung und -abdichtung, Horizontalsperre, Fugenhintergelung, Bauwerksabdichtung in der Konstruktion und Microtunneling, mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung nach DIBt.
Injektionspacker für die Verwendung von PUR Injektionsschaumharzen, von PUR Injektionsharzen, von EP Injektionsharzen, von Acrylatgelen, von PUR Gießschaumharzen und Silikat Injektionslösungen.
Gutachterinstitut für Raumausstattung, Bau- und Fußbodentechnik